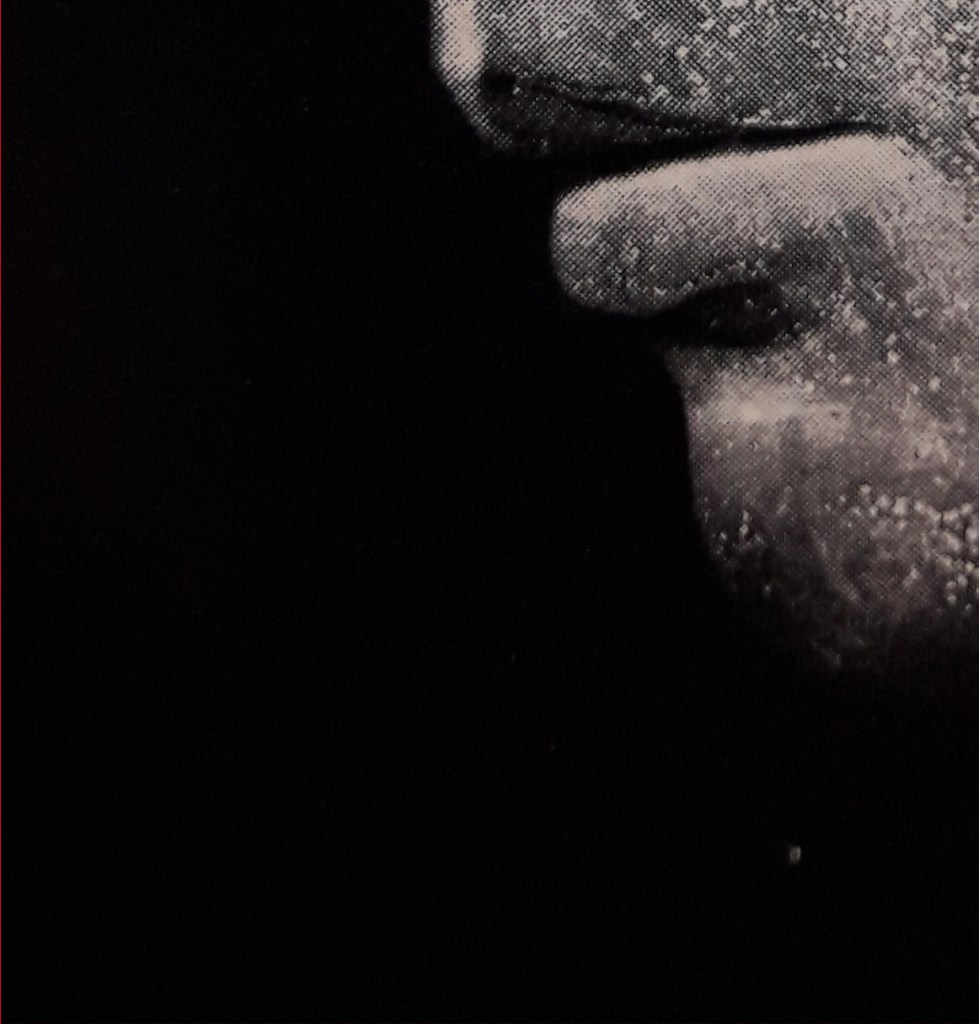In der Frage nach der Weltliteratur steckt – nicht gerade verborgen, die Frage nach der berühmten „großen weiten Welt“. Wie sehr ist das Forschen und Übersetzen an -durch und zwischen die Literaturen geprägt von diesem Verhältnis eines Irgendwo zwischen Geschirr und Bettzeug, auf dem vertrauten Sofa, vor den gut bestückten Bücherregalen, und der Größe der Welt oder der Tiefe der Geschichte?
Ein Gespräch über das Eintauchen, das Fremdsein und die Gastfreundschaft mit der Philosophin und Übersetzerin Melanie Strasser.
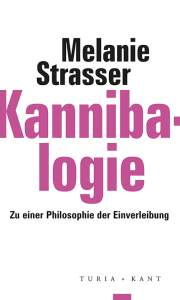
HEARTLAND: Hallo Melanie, du bist in: Sao Paulo! Allein den Namen „Sao Paulo“ zu sagen klingt ja für jemanden weit weg davon, für jede*n in der jeweils eigenen Provinz sozusagen, verheißungsvoll und ein bisschen nach großer Story. Wie ist das gekommen, dass du von Wien nach Sao Paulo gezogen bist, und wie fühlt es sich jetzt an?
Oh ja, der Heilige Paulus, der hätte wohl seine Freude hier. Ich wollte schon immer einmal in einer Stadt leben, in der es kein Ende gibt. São Paulo ist in jeglicher Hinsicht überwältigend. Alles ist größer, voller, lauter, schwer-schwieriger, verwinkelter, verwickelter. Und wenn es regnet, so wie jetzt gerade, dann steht alles still. Es fühlt sich unwirklich an, hier zu sein, immer noch, immer wieder. Ich habe zu meinem Glück und zu meiner Überraschung ein Stipendium bekommen, um hier ein Weilchen zum Thema Gastfreundschaft zu forschen, am Tisch theoretisch, im Alltag praktisch. Ein Stipendium bedeutet, dass die Zeit läuft, aber an das Ende, an das will ich noch nicht denken.
HEARTLAND: Wie kann man sich deinen Forscherinnen-Alltag in Brasilien vorstellen? Gibt es konkrete Projekte, die du verfolgst?
Ein Forschungsalltag ist vor allem ein Suchen. Ich suche, ohne zu wissen, was zu finden ist. Meine Aufgabe ist es, etwas zum Übersetzen als Form von Gastfreundschaft zu sagen zu haben. Am Ende soll ein wissenschaftlicher Artikel dazu entstanden sein. Ich sammle also, ich lese, begebe mich hinein in Philosophien der Gastfreundschaft, der Migration, in Fragen der Ungleichheit und des Zusammenlebens. Was ich hier in Brasilien finde, und wohl nur hier, sind Kosmovisionen, indigene Weltsichten, die einen ganz anderen Blick auf das Übersetzen werfen. Der Ort, an dem man forscht, spielt also hinein, es gibt keinen neutralen Ort, an dem man sitzen und forschen könnte.
HEARTLAND: Wie erlebst du die Gastfreundschaft in Brasilien, fühlst du dich überhaupt als Gast?
Ich bin wohl der ideale Gast: einer, der sich wie zu Hause fühlt, aber wieder geht. Dabei frage ich mich, wo ich zu Hause bin, ob ich irgendwo zu Hause bin. Sind wir jemals zu Hause? Der Mensch hat schließlich keine Wurzeln, er hat Beine. Hier zu sein ist für mich eine seltsame Art des Nachhausekommens. Das liegt daran, dass ich mich im Portugiesischen weitgehend zu Hause fühle. Ohne in der Sprache heimisch zu sein, den Anderen zu verstehen und sich sagen zu können, fühlt man sich wohl immer einsam und fremd. Mich hier aufgehoben zu fühlen, liegt vor allem auch daran, dass man hier aufgenommen wird wie sonst nirgendwo. Jeden Tag strahlt mich jemand an. Jeden Tag plaudert jemand mit mir. Wenn ich Hilfe brauche, muss ich nicht danach rufen. Ich bin ein Gast, der sich so sehr zu Hause fühlt, dass er Dinge tut, die man als Gast besser nicht tut. Ich stelle in Frage, verliere bisweilen die Nerven ob der monströsen Bürokratie und des horrenden Verkehrs, konfrontiere meine Gastgeber mit Missständen, mit der Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die an jeder Ecke lauern. Und stoße dabei fast immer auf Wohlwollen. Das schließt ein gewisses Unverständnis nicht aus, denn was für mich anstößig ist, unzulässig, unbegreifbar, ist für jene, die hier leben, oftmals normal. Es gibt also diese Momente des Fremdseins, des Außens, des Unheimlichen. Das gehört wohl zur Erfahrung des Woandersseins. Dabei ist es lindernd, dass es nicht mein Zuhause ist. Fremder wäre ich, wenn ich bliebe. Vielleicht fühle ich mich gerade deshalb zu Hause, weil ich nicht zu Hause bin, weil ich zu Gast bin.

HEARTLAND: Du sprichst mit dieser Erfahrung des Woanderssein, behaupte ich mal, ja auch ein klassisches Problem an, was vielen Reisenden, gerade denen, die sich als Forschende verstehen, bekannt vorkommen dürfte. Gerade auf der historisch so stark markierten Bahn zwischen Europa und Lateinamerika.
Drängt sich nicht unmittelbar das Problem auf, etwa als Europäer*in in einem „exotischen“ Kontext eine Differenzerfahrung auszubeuten? Wie vermittelt man, auch sich selbst gegenüber, dieses ja total authentische Gefühl einer produktiven Andersheit? Oder anders gefragt: wie schmal ist für dich der Grat zwischen Forschung und der Reproduktion von Klischees?
Ich habe das Glück, nicht „empirisch“ oder „ethnologisch“ zu arbeiten. Ich schreibe nicht explizit über meine Erfahrungen hier, meine Begegnungen. Insofern muss ich meinen Platz zumindest in meiner Arbeit nicht stets hinterfragen. Ich habe auch das Glück, dass ich hier optisch nicht auffalle, und dass das Leben hier für mich mitnichten etwas Exotisches an sich hat. Ich fühle mich insofern gar nicht so anders. Ich will hier vor allem lernen, viel sehen; ich begebe mich auch gerne auf die Spuren von Menschen, die hier gewirkt haben, aber diese Eindrücke schreibend zu verarbeiten, das tue ich bislang nicht – vielleicht aus Angst vor dem Klischee, aus Angst vor der Profanierung. Besonders stark macht sie sich aus, wenn es um Lebensformen geht, vom Zusammenleben in indigenen Communities oder Favelas, von Religionen, von Riten. Das ist für mich schwierig, mich da hineinzubegeben, zugleich zieht es mich da hin. Da nun spüre ich die Andersheit sehr, und ich empfinde sie als nicht sehr produktiv, eher als Schock. Es beeindruckt mich, wie ein von Außen Kommender, einer wie Hubert Fichte, so eintauchen kann in eine vollkommen anders geartete Welt wie die der Religionen Bahias, dass er gar darüber schreiben kann. Es ist wohl eine Frage der Form; es müsste eine Form sein, die das Ethnologische mit dem Poetischen verbindet, eine Form, die gelebte Erfahrung in Literatur wendet.
HEARTLAND: Welche deiner Rollen, als Literatur- und Übersetzungstheoretikerin, Philosophin, literarische Übersetzerin ist im Moment dominant?
Seit ich hier bin, rückt mein ursprüngliches Studienfeld, die Philosophie, wieder verstärkt in den Vordergrund. Und ein für mich doch ziemlich neues Feld zieht mich immer mehr an, die Anthropologie. Das liegt daran, dass der Großteil meiner Kollegen und Kolleginnen hier aus diesem Bereich kommt, das liegt an Brasilien, in dem der Anthropologie ein sehr großer Stellenwert zukommt. Zwischendurch übersetze ich kleinere Dinge, um nicht ganz hinauszufallen aus dieser Dimension. Und immerhin, der Stapel an Büchern, die ich gerne übersetzen wollte, wird wöchentlich höher.

Das babylonische Wörterbuch
Erzählungen. Übersetzt von Marianne Gareis und Melanie P. Strasser, mit einem Nachwort von Manfred Pfister
HEARTLAND: Als literarische Übersetzerin aus dem brasilianischen Portugiesisch hast du dich unter anderem mit Joaquim Maria Machado de Assis beschäftigt, wahrscheinlich der große Klassiker der brasilianischen Literatur. Wie gehst du mit Nähe und Distanz, Angleichung und Fremdheit beim Übersetzen um?
Das lässt sich kaum beantworten. Übersetzen ist ein stetes Ausloten, der Versuch, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Nähe und Distanz, Identifikation und Fremdheit. Aber ich merke, dass ich doch immer mehr dahinkomme, der Fremdheit größeren Raum zu gewähren. Es zuzulassen, dass nicht alles Sinn ergibt. Es zuzulassen, wenn es hakt. Es wird meist der Übersetzung angelastet, wenn ein Text fremd erscheint, wenn es in ihm stolpert, wenn er an den Rand des Verstehens drängt. Dabei ist das doch ein Merkmal großer Literatur, dass Lücken bleiben, Offenheiten, die sich nicht kompensieren lassen. Ich bin hier auf einen Roman gestoßen, in dem sich die Sprache – analog zu den Metamorphosen, die sich in indigenen Kosmovisionen ereignen – vom Portugiesischen in eine kaum noch verständliche Sprache wandelt, die durchsetzt ist von Neologismen, von Tupiismen, indigenen Wörtern aus den unterschiedlichsten Völkern. Es reizt mich sehr, diesen Roman zu übersetzen, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
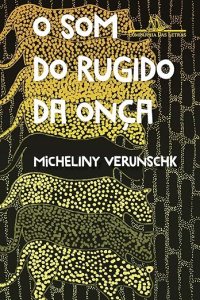
HEARTLAND: Verrätst du uns deine Roman-Entdeckung?
Es handelt sich um die Geschichte von zwei indigenen Kindern, Juri und Miranha, die im Rahmen der berühmten Brasilien-Expedition der beiden deutschen Naturforscher Spix und Martius (1817–1820) nach München verschleppt wurden. Sie waren die einzigen von acht Kindern, die die Schiffsreise überlebten, starben aber bereits wenige Monate nach ihrer Ankunft im deutschen Winter. Der Roman erzählt diese – in unseren Breiten so unbekannte – Geschichte aus ihrer Perspektive. Ich finde, wir in Europa, wir sollten diese Geschichte kennen. Die Autorin lebt in São Paulo und heißt Micheliny Verunschk, ein sehr brasilianischer Name, nicht wahr? Den Titel weiß ich nicht zu übersetzen, aber das Brüllen eines Jaguars klingt in ihm an.
HEARTLAND: Geht’s dir gut im brasilianischen „Winter“?
Es ist der schönste Winter meines Lebens, nicht nur in klimatischer Hinsicht. Es kann kalt werden, nasskalt, grau. Dann stehen wir bei 10,11 Grad in der Nacht, 15 Grad in der Dämmerung, es kommt einem eisig vor. Aber tagsüber strahlt fast immer die Sonne, oft ist es heiß, alles klebt. Und manchmal regnet es so sehr, dass man nichts mehr sieht. Dann sind die Straßen so überströmt, dass sie nirgends mehr hinführen und die Wasserschweine unten am Fluss – „unsere kleinen brasilianischen Nilpferde“ (João Guimarães Rosa) – stehen eng aneinander.
HEARTLAND: Vielleicht teilst du ja auch noch den einen oder anderen Geheimtipp mit uns?


Leider scheint mir, was den deutschsprachigen Raum betrifft, die gesamte brasilianische Literatur ein Geheimtipp zu sein. Ich nenne nur drei Namen, die bekanntesten hierzulande, und die nach wie vor fremd sind bei uns: Machado de Assis, der Größte des 19. Jahrhunderts, João Guimarães Rosa, der Größte und Fremdeste des 20. Jahrhunderts, Clarice Lispector, die Größte, die Fremdeste. Und was das Terrain jenseits der Literatur betrifft: den höchsten Punkt der Stadt im Auge behalten. Nicht vergessen, dass Brasilien wie Böhmen am Meer liegt. Einen leichten Gang üben und sich so oft wie möglich in einem abendlichen Samba auf der Straße auflösen.